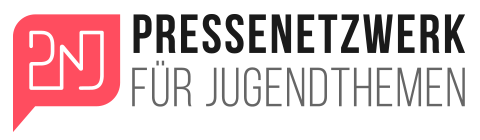Exklusiver Kapitel-Vorabdruck der Kurzgeschichte von Christian Endres aus dem Buch „Pandemie“
„Hast du alles bekommen?“, fragt Tim barsch. Schutzmaske und Gewehr verstärken die negativen Vibes, die von ihm ausgehen.
Ich bringe ihm und seiner Familie seit sechs Monaten die Einkäufe. Tim ist eigentlich kein aggressiver Typ, wirkt heute aber extrem angespannt – vermutlich wegen seiner Frau Sarah, die krank im Bett liegt, wie er mir eben erzählt hat.
Wir sind allein am Rand seines Grundstücks, das komplett von einem hohen, stacheldrahtgekrönten Zaun umgeben ist, der am Gehweg abschließt.
Ich spähe an der großen Einkaufstüte in meinen Armen vorbei, während Tim das Tor aufsperrt. „Alles bis auf die Hefe. Die ist wieder mal alle.“
„Scheiße. Apropos, und Toilettenpapier gab’s diesmal?“
„Jepp. Aber der nächste Run lässt sicher nicht lange auf sich warten. Ist inzwischen zyklisch.“
Tim nickt ernst, nimmt die Tüte entgegen, stellt sie auf seiner Seite des Zauns ab und macht eilig wieder das Tor zu. „Danke, Mann“, sagt er dann, spürbar erleichtert, merklich ruhiger. „Ich hab schon mit PayPal überwiesen.“
„Perfekt. Mach’s gut. Und grüß Sarah von mir. Ist nur eine Erkältung, oder?“
„Yeah. Nur eine Erkältung. Bis nächstes Mal.“
Ich blicke Tim nach, wie er mit Einkaufstüte und Gewehr die Auffahrt zu seinem Einfamilienhaus hochgeht und dabei an buntem Spielzeug im Gras und einem Apfelbaum mit einer Reifenschaukel vorbeikommt, was so gar nicht zum Knast-Ambiente ringsum passt.
Mögest du in interessanten Zeiten leben.
Vor der Pandemie war vieles anders.
Ich hatte zum Beispiel nie etwas mit Souveränen oder mit Preppern zu schaffen.
Wusste gerade mal, dass es sie gab.
Die einen Verschwörungstheoretiker und Staatsgegner, die auf ihre Unabhängigkeit von besagtem Staat pochten und keine Steuern zahlen wollten; die anderen Spinner, die sich auf das Ende der Welt vorbereiteten, indem sie Keller oder sogar Bunker mit Lebensmittelkonserven, Wasserkanistern, Medikamenten, Waffen, Munition, Generatoren und was nicht noch allem zur Vorbereitung auf Endzeit und Apokalypse vollstopften.
Gut möglich, dass ich sie belächelte, wenn ich in einer meiner Timelines oder einem Feed etwas über solche Leute las.
Seit dem Ausbruch von Corona amüsiert sich keiner mehr über sie. Prepper, Hamsterer, Souveräne und Reichsbürger sind jetzt überall. Es gibt sie in allen Abstufungen, und ihre Zahl steigt wie die Neuinfektionsstatistik an schlechten Tagen.
Und ich verdiene eine Menge Geld mit ihnen.
Der lokale Einzelhandel hing bekanntlich schon vor der Corona-Krise in den Seilen. Als arbeitsloser Programmierer mit Ende Vierzig sah ich darin irgendwann eine Chance.
Für mich und andere.
Meine App sollte Kunden und Händler vor Ort vernetzen und zusammenbringen, in einem Viertel, in einer Community, in einer Stadt. Dabei hatte ich vor allem Menschen im Sinn, die wegen physischer oder psychischer Krankheiten nicht ohne Weiteres raus konnten und es sicher zu schätzen wüssten, ihre Einkäufe per Klick von Zuhause und trotzdem in den Geschäften ihrer Umgebung zu tätigen und sie zeitnah geliefert zu bekommen.
Am Anfang machten lediglich ein paar Händler mit: ein kleiner Supermarkt, der noch zu keiner Kette gehörte; ein Bäcker; ein Metzger; eine Apotheke; die Gärtnerei kurz nach dem Ortseingang; ein paar Landwirte, zwei davon bio; ein Schreibwaren- und Zeitschriftenladen; ein Buchhändler in zweiter Generation.
Ich lieferte die über meine App bestellten Produkte alle selbst in einem gebraucht gekauften Lieferwagen mit Kühlkasten aus, an dem das edelste die Folie war, mit der ich Logo und Webadresse aufgezogen hatte. Drehte den ganzen Tag meine Runden zwischen Läden und Kunden, arbeite Einkaufsliste um Einkaufsliste, Bestellung um Bestellung ab.
Meine Stammkunden? Wie erwartet viele ältere Menschen, die sich noch an die Zeiten vor der Globalisierung erinnerten und die eine lokale und persönliche Komponente wirklich schätzten; aber auch überraschend viele jüngere Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zum Einkaufen konnten (oder wollten) und lieber kleine Geschäfte vor Ort unterstützten, statt bei einem der Riesen online zu ordern.
Es war eine gute Idee, ich hatte eine solide App programmiert, und die Leute hier sprangen durchaus drauf an. Der Gewinn reichte für die Miete, für Benzin, Internet und Netflix – aber es war nichts, um reich zu werden. Der große Durchbruch blieb aus. Mein Unternehmen köchelte auf zu niedriger Flamme vor sich hin. Ich twitterte und facebookte und instagramte mir die Finger wund und verbrachte Nächte damit, Youtube-Clips zu produzieren, die mir mehr Kunden und, noch besser, Investoren oder gleich Käufer für die App bescheren sollten. Sogar Fernsehen und Zeitung berichteten über mich.
Brachte jedoch alles nichts.
So ging das knapp zwei Jahre, und an meinen 50. Geburtstag überlegte ich, wie lange ich noch weitermachen konnte, wenn sich nichts bewegte.
Dann kam Covid-19.
Das ist jetzt achtzehn Monate her.
Anderthalb Jahre.
Ein Wurmfurz im Konzert der Ewigkeit.
Und dennoch.
Heute beschäftige ich ein halbes Dutzend Angestellter, die in den Läden Bestellungen zusammenpacken, ausfahren oder per Chat und Telefon Kundensupport leisten. Darüber hinaus laufen endlich Gespräche, mit meinem Kleinstadt-Geschäftsmodell in größere Orte zu expandieren.
Die App ist trotz allem noch immer kein bisschen fancy, sondern weiterhin basic, sodass jeder mit rudimentären Tech-Skills sie bedienen kann – ich habe stets meinen Vater vor Augen, wenn ich ein Feature designe und einbaue. Allerdings kamen Funktionen wie die Express-Lieferung und der Lebenswichtig-SOS-Button hinzu, bei dem ich keinen Spaß verstehe, wenn ihn jemand für sinnlosen Kram missbraucht.
Während der ersten fatalen Welle der Covid-19-Pandemie haben mehr und mehr Menschen, die das Haus aufgrund einer Risikogruppenzugehörigkeit oder schlichtweg aus Angst nicht mehr verlassen wollten, meine App und Dienstleistung in Anspruch genommen – und sie Verwandten, Freunden und Nachbarn empfohlen (diejenigen zumindest, die keine Sorge hatten, dass dadurch Engpässe entstehen, die sie selbst treffen mochten).
Mit jedem Lockdown, dessen Beschränkungen zurückgefahren und bei steigenden Krankenzahlen wieder angezogen wurden, bekam ich mehr zu tun. Online-Portale mit Händlerlisten und -Links waren ja schön und gut, doch als die schwächelnde Post immer längere Laufzeiten bekam und auffallend viele Pakete unterwegs verschwanden, wurde ich mit meinem Service vor Ort eine echte Alternative, obwohl auch den lokalen Läden öfters Dinge ausgehen.
Inzwischen hat sich eine noch größere Anzahl Menschen in ihre Häuser zurückgezogen, unabhängig von den Lockdown-Gezeiten oder den Risikogruppen. Es entwickelt sich zum neuen Lebensstandard derer, die nicht einfach weiter Vollgas geben, sobald erlaubt.
Gleichzeitig fühlen sich Prepper und Souveräne in ihrer Lebensart bestätigt, weil die Infektion ja schließlich von außen kommt, weil sie dem Staat Versagen vorwerfen oder weil sie immer wussten, dass Chaos und Kollaps nahen. Sie bunkern jetzt erst recht, was das Zeug hält, und schotten sich ab, so weit es geht.
Und werden vom System und der Gesellschaft komplett toleriert.
Kein Wunder: Selbst für Menschen mit einst gar keinen Neigungen in diese Richtung wurde das eigene Grundstück zur sicheren Insel, die sie nicht verlassen wollen – Andere sind maximal bis zum Hoftor oder der Haustür erwünscht, wo sie flugs abladen und sich dann bitte schleunigst verpissen dürfen.
Eiserne Selbstisolation als Evolutionsschritt.
Ich lache jedes Mal, wenn ein Politiker meint, Corona habe die Menschheit nicht verändert, und wir alle seien enger zusammengerückt.
Solange Lieferungen per Drohne noch in den Bereich Science Fiction fallen, boomt mein Geschäft.
Und ich treffe ein paar echt interessante Leute.
Einige derer, die seit den Tagen vor Corona über meine App einkaufen, sind mir ans Herz gewachsen.
Etwa die Winters. Zauberhaftes älteres Ehepaar, mit neunundfünfzig gemeinsamen Jahren auf dem Zähler. Sie streiten sogar altmodisch, wenn ich ihre Tüten und Pakete in die Küche schleppe und Frau Winters jedes Mal sagt, dass ich unter der Schutzmaske bestimmt ein Gesicht verstecke, das ihrer Tochter gefallen würde, woraufhin ihr schwer auf seinen Gehwagen gestützter Mann sie jedes Mal bittet, uns alle verdammt noch mal nicht so in Verlegenheit zu bringen.
Natürlich gibt es auch unangenehme Zeitgenossen.
Tim, der nervöse Familienvater und Neu-Souveräne, ist da noch harmlos, Gewehr und Zwinger hin oder her.
Im Moment bin ich auf dem Weg zu einem meiner schlimmsten Kunden, bei dem das Schauder-O-Meter heftig ausschlägt.
Meine sonst extrem zuverlässigen Fahrer weigern sich, ihm Waren zu bringen, und lassen sich von ihrem Arzt zur Not für den Rest der Woche per Telefon als hoffentlich-erkältet krank schreiben, wenn er auf dem Fahrplan auftaucht.
Die Rede ist von Arthur Lamp.
Der war schon vor Covid-19 der ungekrönte König der Staatsgegner und Prepper in dieser Gegend.
Er hat sogar einen Bunker.
Seine Frau Sina starb auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle. Arthur, seine Söhne Frank und Michael sowie seine Tochter Josie verlassen das weitläufige, von Maschen- und Stacheldrahtzaun geschützte Grundstück ihres Aussiedlerhofes, an das ein kleiner Privatwald grenzt, mittlerweile so gut wie gar nicht mehr.
Nach dem Tod seiner Frau ist Arthur ganz abgerutscht und will die totale Isolation von der ansteckenden, verkommenen, verdorbenen Welt.
Ich bin das notwendige Übel, das er alle paar Monate erduldet, damit er nicht an die heiligen Lagerbestände im Bunker ran muss, die seiner Familie durch die Apokalypse helfen sollen.
Mein Lieferwagen, dessen Kühlung angestrengt hinter mir summt, rumpelt über die staubige, geschotterte Zugangsstraße zum Hof, auf dem bereits Arthurs Vater kein Vieh mehr hielt und auf dessen verdorrten Feldern nichts wächst.
Bei den Lamps läuft es jedes Mal gleich ab. Ich fahre am Zaun vor, hupe und warte. Nach einer Weile kommen Arthur und seine Kinder zur Schleuse, die aus zwei stählernen Rolltoren besteht und die sie mir öffnen, sodass ich den Lieferwagen zwischen die Tore fahren kann.
Arthur ist dürr, rotgesichtig und kahl – er erinnert an einen Truthahngeier. Frank und Michael, vierzehn und sechzehn, scheinen viel Zeit auf der einsamen Casa da Lamp mit Bodybuilding zu verbringen. Josie, die dieses Jahr achtzehn werden müsste, hat das Aussehen ihrer Mutter geerbt, und ihre Augen über der Schutzmaske sehen stets traurig aus.
Ja, selbst Anti-Bürger wie die Lamps folgen dem Gesetz zum Tragen von Masken, wenngleich sie wahrscheinlich kaum das Allgemeinwohl im Sinn haben.
Irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, dass Arthur mit einer Pumpgun und einer Meute kläffender Hunde hinter dem Schleusentor steht, das mich von seinem Hof trennt, derweil ich am Heck des Lieferwagens meiner Arbeit nachgehe.
Früher habe ich noch versucht, die Situation mit Sprüchen aufzulockern. Jetzt sage ich zu niemand Bestimmtem Hallo, lade mit Unterstützung der Lamp-Kids ab, verabschiede mich wortkarg, steige in den Wagen und sehe zu, dass ich abhaue.
Jeder Besuch auf dem Hof der Lamps, den Arthur mit anonymen Bitcoins vergeltet, schlägt mir brutal aufs Gemüt.
Weil wegen der jüngsten Lockdown-Verschärfung kaum Autos unterwegs sind, achte ich wieder einmal mehr auf meine düsteren Gedanken als auf die Straße vor mir oder die Stille, die an manchen Tagen in der Welt seit Corona förmlich greifbar ist.
Arthur Lamp ist innerhalb meines persönlichen Bewegungsradius ein eindringliches Beispiel dafür, wie krass das Virus die Dinge teilweise verändert hat, wie viel schlimmer manches geworden ist unter dem blauen Himmel, der kaum noch Kondensstreifen kennt.
Das miese Gefühl folgt mir vom Hof der Lamps bis in den Ort und meine Firma – das Gebäude beherbergte früher einen Partyservice, der in der ersten Phase der Pandemie pleite ging.
Ich parke den Wagen, steige aus und fische mein Smartphone aus der Jeans, um die News und das Update der Infektionszahlen zu checken, was man es längst routinemäßig tut.
Dabei ertaste ich ein zusammengefaltetes Stück Papier in der Hosentasche, das da heute Morgen noch nicht war und das ich selbst seitdem nicht hineingetan habe.
Ich entfalte das Blatt und staune nicht schlecht, da es sich als Brief von Josie Lamp entpuppt.
Sie muss ihn mir beim Entladen in der Schleuse heimlich zugesteckt haben.
Ich fange an zu lesen.
Sie schreibt, dass ihr Vater den Verstand verloren habe (ach?). Er untersage ihnen das Verlassen ihres Anwesens und verbiete jegliche Kommunikation mit der Außenwelt. Er verhalte sich unberechenbar und impulsiv, und ihre Brüder würden ihm von Tag zu Tag mehr nacheifern. Sie sperren Josie sogar nachts ein, weil sie befürchten, sie könne weglaufen.
Die verschlossene Tür sei letztlich aber ein Segen, der nicht ewig halten würde.
(Der Satz macht mich echt fertig.)
Zudem hätte ihr Vater zuletzt öfter angedeutet, dass sie bald in den Bunker ziehen, denn es werde in Kürze so weit sein.
(Was er damit meint? Impf-Pflicht oder Zombie-Apokalypse? Wer kann das schon sagen …)
Ein Leben im Bunker, so Josie, könnte sie noch weniger ertragen als dieses.
(Da bin ich ganz bei ihr. Egal wie übel es hier draußen wird, ich würde mich auch nie wegsperren – das wäre kein Leben).
Josie bittet mich deshalb, sie da rauszuholen, bevor es für sie zu spät ist.
Nicht mit einem Polizeieinsatzkommando, weil ihr Vater und ihre Brüder schwer bewaffnet sind und ein Gemetzel gäbe.
Ich soll sie mit meinem Lieferwagen an einem Treffpunkt aufsammeln und fortbringen, egal wohin, Hauptsache weg.
Sie schreibt in ihrer eckigen, engen, gehetzten Handschrift, dass sie kein Recht habe, mich darum zu bitten. Doch falls ich ihr helfen wolle, soll ich morgen früh ab Vier am Waldrand auf der anderen Seite des Hofes warten. Ihre Familie gehe dort auf die Jagd und schleppe Josie stets mit. Sie will sich davonstehlen, über den Zaun klettern und, wenn ich da sein sollte, bei mir einsteigen. Zu Fuß wäre es nicht zu schaffen – ihr Vater und ihre Brüder würden von Innen den Zaun am Boden ein Stück hochbiegen und ihr die Hunde hinterherjagen.
Mit mir als Fluchtwagenfahrer sei es machbar, meint Josie.
Mein erster Gedanke ist, zur Polizei zu gehen. Die werden ja wohl mit einem souveränen Drecksack fertigwerden, oder? Nur was, wenn es zu einem Blutbad kommt, Josie im Kreuzfeuer getroffen wird, Polizisten sterben? Käme ich damit klar?
Aus demselben Grund wende ich mich an keinen meiner Angestellten oder Freunde.
Und kann sein, dass mir die Aussicht gefällt, in diesen Zeiten etwas Heldenhafteres zu tun, als per App bestellte Nudeln, Zigaretten, Cola, Schokolade und Kondome auszuliefern.
Ich entschließe mich also, die Sache alleine zu regeln und das arme Mädchen da morgen früh rauszuholen.
Ich fahre durch die vernachlässigten Felder und sehe mehr Rehe, Hasen und Füchse als in meinem gesamten Leben zuvor.
Der Natur hat Corona definitiv geholfen.
Und ja, auf der freien Fläche hätte Josie gegen die Hunde ihres bekloppten Vaters nichts zu gewinnen.
Das Waldstück hinter dem Aussiedlerhof der Lamps ist ebenfalls mit Maschendraht eingezäunt. Gelbe Schilder raten einem, umzudrehen.
Die vom Blitz getroffene Eiche taugt selbst im dunstigen Morgengrauen als unübersehbarer Wegweiser, um von Weitem die Stelle zu finden, an der ich diesseits des Zauns auf Josie warten soll.
Ich schalte Motor und Scheinwerfer aus und starre in den Wald, wo Vögel schreien, zwitschern und keckern.
Ich teile ihren Optimismus, was den neuen Tag angeht, nicht.
Meine Nacht war weitgehend schlaflos und voll von Sorgen und Zweifeln, der Sternenhimmel, seit Corona so klar und funkelnd wie anno dazumal, keinerlei Trost oder Beruhigung.
Während des Wartens kommen mir weitere Zweifel an der Aktion.
Ich bin kein Held. Nur ein Programmierer und Unternehmer, der an einer Pandemie verdient und sich, als er das hier für eine gute Idee hielt, zu sehr wie Jason Statham fühlte.
Wem mach ich etwas vor? Habe ich in einer Welt, die sich so rasant und rapide verändert hat, nicht genug Nervenkitzel jeden Tag, an dem das Virus einen erwischen könnte, wenn man draußen unterwegs ist? Habe ich denn echt so ein schlechtes Gewissen, weil ich mit freidrehenden Typen wie Arthur Lamp Geschäfte mache und nicht wissen will, wie er zwischen Darknet und Souveränen-Netzwerk an Geld kommt, ohne sein umzäuntes Eiland zu verlassen?
Gerade als mich meine Bedenken praktisch in ein Nervenwrack verwandelt haben, kracht im Wald ein Schuss.
Laut hallt er durch die morgendliche Luft.
Das Konzert der Vögel verstummt abrupt, dafür setzt nicht allzu fern erregtes Hundegebell ein.
Da sehe ich Josie zwischen den Bäumen auf den Zaun zukommen – sie humpelt und schleppt sich mehr voran als dass sie geht.
Hat der Scheißkerl etwa seine eigene Tochter angeschossen? Oder ist sie gestürzt und hat sich verletzt?
Mir wird klar, dass Josie es in dieser Verfassung nie und nimmer über den Zaun schafft.
Dass ich eine Entscheidung treffen muss.
Ich drehe den Zündschlüssel, ramme den störrischen Rückwärtsgang rein und setze mit aufheulendem Motor zurück.
Eine harte Vollbremsung später schalte ich in den ersten Gang, trete das Gaspedal durch und brettere genau auf den Zaun zu.
Josie hat erkannt, was ich vorhabe, und humpelt zur Seite, damit sie nicht im Weg steht, als ich nun mit dem Lieferwagen den Zaun plätte und so einen Fluchtweg freimache.
Der schwere, bullige Lieferwagen eignet sich vorzüglich dafür, ein, zwei Felder Maschendrahtzaun niederzumähen. Leider ist die alte Karre umso weniger für tollkühne Stunts auf dem wurzeligen, unebenen Waldboden gemacht. Bei dem Versuch, den Wagen vor dem ersten Baum herumzureißen und in Richtung Feld zu wenden, kommt er ins Schleudern; ich verliere die Kontrolle über den ausbrechenden Hobel und schleudere seitlich gegen einen mächtigen Eichenstamm. Der Motor geht aus, und kein Fluchen oder Flehen dieser Welt kann ihn dazu überreden, wieder anzuspringen.
Josie erscheint an der Fahrertür. Es ist das erste Mal, dass ich sie ohne Maske sehe. Sie sieht aus wie ein Tier im Fluchtmodus. Ich wünschte, sie hätte einen Grund zu lächeln.
Sobald die Tür offen ist, höre ich das sich nähernde Hundegebell und die wütenden Rufe von Männern.
Ich hatte während der gesamten Pandemie noch nie so viel Angst um mein Leben wie in diesem Augenblick.
„Danke“, sagt Josie schlicht, und ich brauche eine Sekunde, um zu schnallen, dass sie nicht wusste, ob ich überhaupt da sein werde.
Doch was hat es gebracht? „Er springt nicht mehr an“, sage ich kläglich. „Tut mir leid, ich hab’s verbockt.“
Josie greift nach meinem Handgelenk und zieht mich aus dem Wagen. Ich starre ihr blutgetränktes Hosenbein an.
„Was jetzt?“, frage ich. „Die sind gleich hier. Wir beide rennen querfeldein keinem Hund und keiner Kugel davon.“
Josie hat meine Hand nicht losgelassen. Sie zerrt mich in eine Richtung, auf der Innenseite des Zauns und am Waldrand entlang.
„Komm. Der Bunker ist nicht weit. Das kann ich selbst mit meinem Bein schaffen. Wenn du mich stützt.“
Die bedrohliche Präsenz der Hunde und der Männer wird immer massiver.
Josie, die meines Wissens nach nicht einmal meinen Vornamen kennt, sieht mir flehend in die Augen.
„Bitte. Der Bunker ist unsere einzige Chance. Wir können ihn von innen verriegeln. Dann sind wir sicher vor ihnen. Und allem anderen.“
Ausgerechnet der Bunker, der für keinen von uns beiden bis zu diesem Moment eine Option war.
Und wie lange sitzen wir dann da drin?
Besser als Abgeknalltwerden?
Meine Gedanken rasen.
Aber wenn diese Pandemie mich eines gelehrt hat, dann dies:
Wir alle können uns schnell anpassen.
Exklusiver Vorabdruck aus:
Hans Jürgen Kugler, René Moreau (Hrsg.):
Pandemie
Geschichten zur Zeitenwende
Hirnkost Verlag, Oktober 2020
Hardcover, 372 Seiten, illustrierte Ausgabe
ISBN: 978-3-948675-59-2
Ein Virus verändert die Welt. Es gibt eine Zeit vor und nach Corona. Wir alle erleben gerade eine Zeitenwende wie aus dem Szenario eines düsteren Science-Fiction-Films. Die 33 Autor*innen des Buches „Pandemie“ https://shop.hirnkost.de/produkt/pandemie-geschichten-zur-zeitenwende/ haben sich Gedanken über die Zeit nach Corona gemacht und aufwühlende, spannende und berührende Geschichten über das Leben mit dem Virus und das Überleben nach der Pandemie verfasst, aber auch bewegende Stories über die Liebe in Zeiten der Corona geschrieben und darüber, was das Virus mit uns macht.
Denn das neuartige Virus tötet nicht nur, es hat auch tiefgreifende und nachhaltige Auswirkungen auf Demokratie und Gesellschaft. Diesem Prozess sind wir nicht hilflos ausgeliefert, wir können ihn mitgestalten. Es muss kein böses Ende geben. Die Zukunft entscheidet sich jetzt.
Beitragsfoto: hp-koch auf unsplash